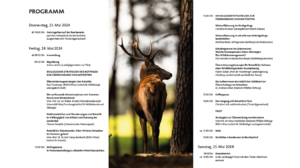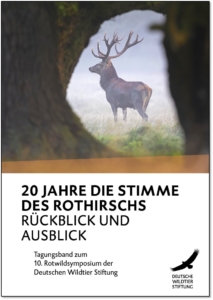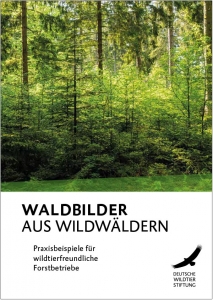Hamburg hat jetzt eine Botschaft der Wildtiere
Wildtiere mit Flügeln, auf Hufen, zwei, vier, sechs oder acht Beinen, mit Flossen, Horn oder Geweih, manche winzig, manche riesig – sie alle stellten sich seit dem 31. August in der Botschaft der Wildtiere in der Hamburger HafenCity vor. Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Elbmetropole können seither die faszinierenden Lebenswelten von Vögeln, Säugetieren und Insekten zu entdecken. Die Botschaft der Wildtiere im „roots“, Deutschlands höchstem Holzhochhaus, ist ein Projekt der Deutschen Wildtier Stiftung. Hier warten eine interaktive Dauerausstellung, eine Lernwerkstatt für Grundschüler und Familien, Deutschlands erstes Naturfilmkino und ab Herbst auch ein Restaurant auf Besucher.
Zur Bildergalerie der Eröffnungsfeier und vom Tag der offenen Tür
Interaktive Ausstellung über heimische Wildtiere
Wie wohnen Fuchs und Grünspecht? Wie sehen Steinadler und Stubenfliege die Welt? Warum können Wildschweine alles fressen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es in der 2.200 Quadratmeter großen Dauerausstellung und in der Lernwerkstatt. Auch die Herausforderungen, denen sich Wildtiere in unserer Kulturlandschaft stellen müssen, werden thematisiert. Da geht es um Lebensraumverlust, Nahrungsmangel und fehlende Versteckmöglichkeiten, aber auch um Dinge, die jeder tun kann, um Wildtieren zu helfen – etwa wilde Ecken in Gärten oder Nisthilfen für Vögel und Wildbienen. Dieses geballte Wissen wird auf spielerische Art vermittelt, an interaktiven Stationen und Themeninseln, die alle Sinne ansprechen. „In unserer digitalisierten Welt ist die Botschaft der Wildtiere in einer Metropole ein Segen. Hamburg darf sich glücklich schätzen, die Deutsche Wildtier Stiftung zu haben – einen Pfeiler gegen die Naturentfremdung“, erklärte Reinhold Messner in seiner Laudatio. Der Extrembergsteiger und Naturschützer war Ehrengast der Eröffnungsfeier.
Zur Website Botschaft der Wildtiere
Naturfilmkino jeden Mittwoch
Begeisterung für die Natur soll auch das neue Naturfilmkino wecken. Es ist das erste seiner Art in Deutschland und lockt Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm in die HafenCity. Einmal pro Woche, am Naturfilm-Mittwoch, werden hier faszinierende Dokumentationen zu sehen sein. Der NDR wird im Rahmen des Naturfilm-Mittwochs einmal im Monat eigene Produktionen zeigen.
Am Mittwoch dem 18. September 2024 läuft ab 19 Uhr der Film Das geheime Leben der Rothirsche von Axel Gebauer. Der Film zeigt interessante, verblüffende und unbekannte Details aus dem Leben der Rothirsche in der abwechslungsreichen Landschaft der sächsischen und brandenburgischen Lausitz.
Ab Februar 2025 laufen dann die Wettbewerbsfilme der European Wildlife Film Awards, des höchstdotierten europäischen Naturfilmpreises, den die Deutsche Wildtier Stiftung vor Kurzem ins Leben gerufen hat. „Die Natur schreibt die spannendsten Drehbücher. In unserem Naturfilmkino kann man die besten Filme über unsere heimische Tierwelt in außergewöhnlicher Atmosphäre genießen. Nach Filmende stehen Filmemacher und Wildtierexperten für Fragen zur Verfügung. In der Botschaft der Wildtiere bekommt der europäische Naturfilm damit eine permanente Adresse“, sagte Professor Dr. Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung.